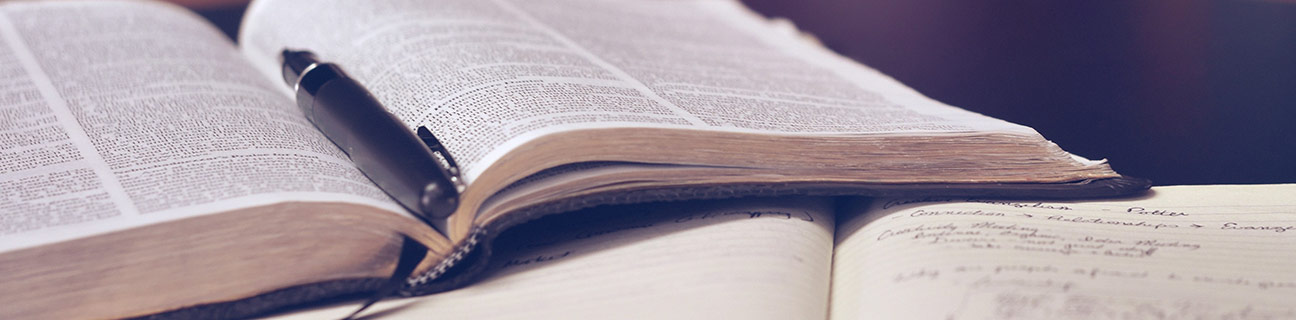Cultural Impact Assessment
In diesem Aufgabenfeld des Arbeitsbereichs „Inwertsetzung von Kultur“ beziehen sich die Mitarbeiter:innen mit dem Begriff des „Cultural Impact Assessment“ (CIA, deutsch: Kulturverträglichkeitsprüfung) explizit auf internationale Diskurse, die sowohl im Kontext internationaler Kulturpolitik der UNESCO zu finden sind, als auch als Erweiterungen eines „Environmental and Social Impact Assessment“ (deutsch: Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung) insbesondere mit Bezug auf indigene Bevölkerungen entwickelt wurden. Dabei werden auch neuere Ansätze aus dem „Social Impact Assessment“ wie der „Social Return on Investment“-Ansatz (SROI, deutsch: Sozialrendite) bedarfsorientiert adaptiert.
In Deutschland hat sich im vergangenen Jahrzehnt ein vergleichbares wissenschaftliches Feld in der Evaluationsforschung entwickelt, das explizit auf Bereiche des Kulturmanagements und der Kulturpolitik gerichtet ist. In der internationalen Evaluationsforschung gewinnen zudem „kulturell sensitive“ Ansätze Raum, die die wachsende kulturelle Diversität moderner Gesellschaften im Blick haben. Insgesamt handelt es sich um ein junges und wachsendes Wissenschaftsfeld. Es ist ein Aufgabenfeld, auf dem die Abteilung Regionalentwicklung und Minderheitenschutz einen nennenswerten wissenschaftlichen Beitrag leisten und zugleich anwendungsorientierte Ergebnisse für den Strukturwandel, die Minderheiten- und die Kulturpolitik einbringen kann.
Das Aufgabenfeld umfasst vier Arbeitspakete:
Im Arbeitspaket „Theoretische und Methodische Grundlagen“ werden der Stand der Forschung zu „(Cultural) Impact Assessment“ aufgearbeitet, die unterschiedlichen Zugänge verglichen und darauf aufbauend ein konzeptioneller Zugang entwickelt, der die Grundlage für die eigenen empirischen Arbeiten bildet. Im Austausch mit der internationalen Impact-Assessment-Forschung erfolgt eine finale Schärfung dieses konzeptionellen Zugangs.
Im Arbeitspaket „Tagebaufolgen: Rekonstruktive Fallstudien“ werden in mehreren, rekonstruktiven Fallstudien die Langzeitauswirkungen von bergbaubedingten Umsiedlungen auf die örtliche, oftmals sorbisch/wendisch geprägte Kultur untersucht. Hierbei kommt der zuvor entwickelte methodische Ansatz zur Anwendung. Ziel der Fallstudien ist es zum einen, den Gegenstand der zu untersuchenden „Kultur“ zu konkretisieren und Wirkungsmechanismen zu identifizieren, die sich (in der Regel) negativ auf diese ausgewirkt haben. Zum anderen wird untersucht, ob und wie Maßnahmen, die zur Bewahrung von Kultur beitragen sollten, gewirkt haben.
Im Arbeitspaket „Kulturelle Effekte von Welterbevorhaben“ soll – mit Blick auf die aktuelle Welterbeinitiative für die Lausitzer Tagebaufolgelandschaft und deren minderheitenkulturelle Implikationen – der Stand der Forschung zu den kulturellen Auswirkungen von Welterbeinitiativen aufgearbeitet und in ausgewählten Vergleichsregionen untersucht werden. Ziel ist die Spezifizierung eines methodischen Ansatzes für ein minderheitenorientiertes CIA für Welterbevorhaben am Beispiel der Welterbeinitiative für die Lausitzer Tagebaufolgelandschaft.
Im Arbeitspaket „Tagebaufolgen: Exploration internationaler Erfahrungen“, das auf den anderen Vorarbeiten aufbaut, soll der zuvor entwickelte Ansatz in einem internationalen Vergleich geschärft, explorativ angewendet und getestet werden. Ziel ist, die so gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Einbindung minderheitenkultureller Spezifika in regionale Entwicklungsvorhaben und die damit verbundenen Planungen gesellschaftlicher Transformationsprozesse aufzubereiten und für verwandte Arbeitsbereiche in der Abteilung Regionalentwicklung und Minderheitenschutz nutzbar zu machen.
Projektleitung: Lutz LaschewskiProjektbeteiligte: Jenny Hagemann, Dr. Fabian Jacobs (bis 07/24)